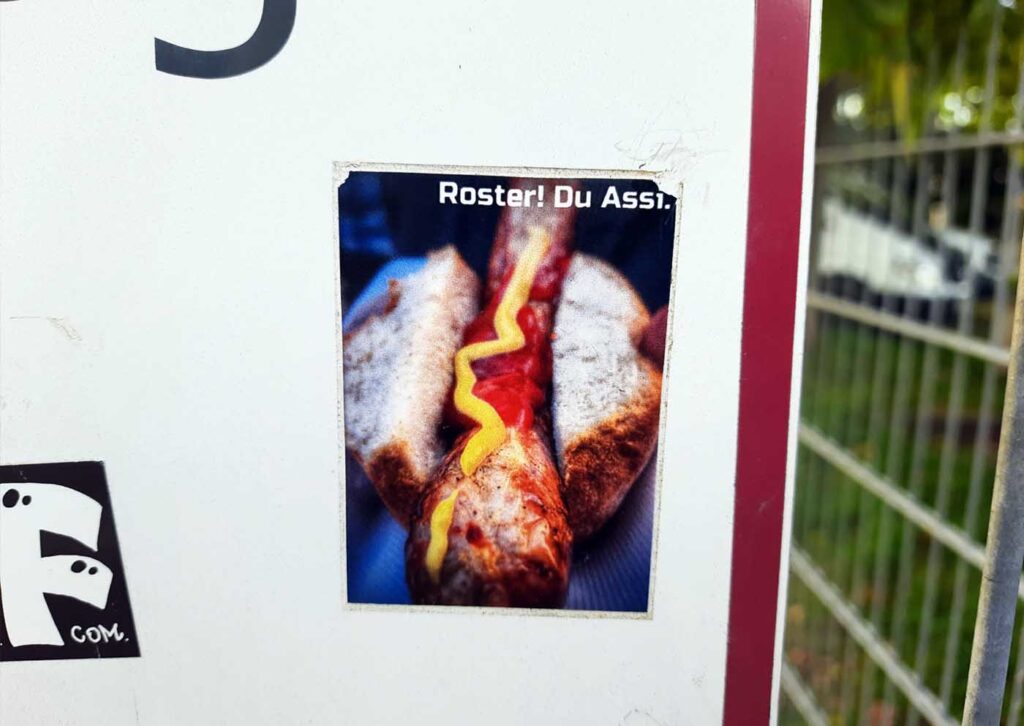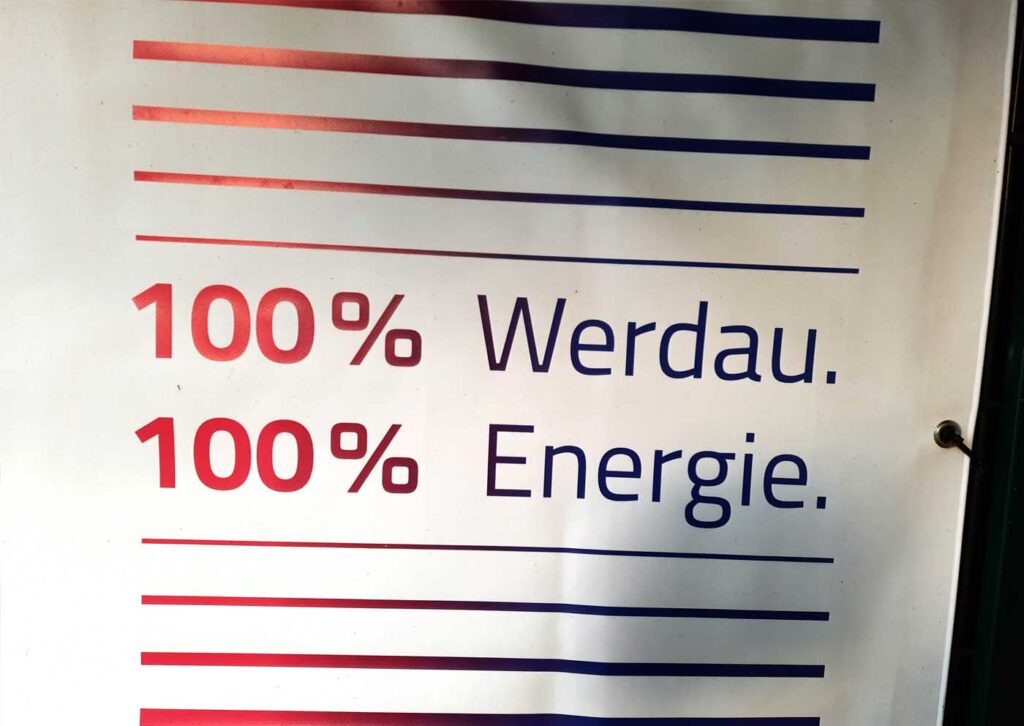I. Sachsenstolz & Sachsenscham
In den 1990er Jahren begriff ich, dass ich mich für meine Heimat schämen sollte. Es waren die Sketchshows, die sich an amerikanischen Vorbildern orientierten, waren die Komiker mit ihren Monologen in einem Genre, das damals seit Kurzem erst Comedy genannt wurde, sie imitierten, was sie als sächsischen Dialekt vermuteten und die Leute lachten, die Pointe hatte meistens nichts mit Sachsen zu tun, es ging irgendwie um das, was in den Talkshows und später in den Scripted-Reality-Formaten als Unterschicht inszeniert wurde, ein bisschen Assi, ein bisschen zurückgeblieben, auf ordinäre Weise unterbelichtet, das war die Pointe, deshalb lachten die Leute und um dieses Lachen zu erzeugen, brauchte es nur das Sprechen meiner Heimat.
Ich hatte mir zuvor nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Familie im Erzgebirge, Familie im Vogtland, Freunde bei Leipzig und Dresden, ich lebte in Westsachsen – das eine Sächsisch gab es nicht. Ich stellte fest, dass es das doch gab: in der Vorstellung anderer. Und dieses Sächsisch hatte einen Ruf, übel war der, und damit war nicht das übelst gemeint, das meine Freunde dem voranstellten, was sie besonders bemerkenswert fanden.
Als ich wegging aus meiner Heimat, dort, wo ich nun war, sprach ich Hochdeutsch – oder zumindest das, was dafür hingenommen wurde, auch wenn sich bei bestimmten Wörtern verräterische Laute einschlichen. Wer sich bemühte, konnte in meinem Sprechen noch meine Herkunft hören. Aber die Comedians hätten mein Sprechen nicht mehr so ohne Weiteres zum Zentrum ihrer Punchlines machen können.
Mit dem Abstand zum Sprechen kam der Abstand zum Land oder auch umgedreht, und vielleicht hätte sich das mit der eingebildeten Scham irgendwann erledigt und wäre zur üblichen Melancholie, vielleicht Sehnsucht geworden, mit der man später die Heimat seiner Kindheit und Jugend betrachtet. Aber es gab: Zwickau. Gruppe Freital. Heidenau. Bautzen. Hortkinder in Pirna legen Hakenkreuze aus Bausteinen. Clausnitz. Chemnitz-Sonnenberg. Dresden, immer wieder Dresden. Pegida. NSU. Dritter Weg. Schild-und-Schwert. Hase, du bleibst hier. Freie Sachsen. SSS usw. Sachsen wurde deutschlandweit akzeptiertes Synonym für Dunkeldeutschland, nicht in Worten nur, auch in Taten, gerade in Taten.
So war es und anderswo fand es auch statt, bestimmte Anhänger von Borussia Dortmund unterschieden sich kein Bisschen von denen von Dynamo und HoGeSa marschierten in Köln und am 17. August wird im fränkischen Wunsiedel marschiert und Schnellroda liegt in Sachsen-Anhalt und Nordkreuz in Meck-Pomm und Thüringen ist vollgepflastert mit Goldenen Löwen.
Das ist so und steht in keinem Gegensatz und entschuldigt nichts, aber irgendwie war es auch so, dass eine Tat in Sachsen nicht selten sinnbildhaft stand für ein ganzes Bundesland, Charakterbeweis war für vier Millionen, sächsisch als dunkeldumpfe Mentalität und vielleicht gab und gibt es dieses Systemische, natürlich ist das so, eine Vielzahl von Gründen und Historien und Strukturen in Politik, Polizei, Institutionen, damals König Kurt und seine herbeigetrotzte Immunität, heute die beflissen ausgeaschte Brandmauer, das Einigeln in den Bergtälern, die Landnahme der Provinz, die gemütliche Kungelei und das volkstümliche Sympathisieren.
Jedenfalls ist Sächsisch auch symbolisch, egal, wie komplex und differenziert ich darüber nachdenken möchte. Wie verhält man sich einem Symbol gegenüber? Wie verhält man sich, wenn man aus diesem Symbol stammt, dort Jahrzehnte verbracht hat, viele der Geschichten kennt, die das Symbol widerlegen und jene, die es bestätigen?
Vielleicht ist es so: Wenn ich in Sachsen war, fragte ich nach dem Bestätigen, wollte hören, wohin der Sachsenstolz geführt hatte. Außerhalb erzählte ich eher von den anderen Geschichten, berichtete von denen, die im Gegensatz zu mir geblieben waren, jene, die sich gegen das Symbol stellten, viele ohne viel Aufhebens, andere, die viel dafür riskierten. Und nun klaube ich für einen Text über Heimat – dieses vollgestopfte und entleerte Wort »Heimat« –, über meine Heimat, die nun mal Sachsen ist, Texte und Gedankenfetzen aus fünfzehn Jahren zusammen, bereite eine Mische zu, die nichts beantworten kann, die nichts rechtfertigen soll, die keine Erklärung liefern muss, sondern Sammlung ist, nur Sammlung, unvollständig, subjektive Ausschnitte beinhaltet, die gerade so an der Oberfläche von Erinnerungen kratzen, um irgendwie anfangen zu können.
II. Stadt der Antiquitätenläden

Der Werdauer Bahnhof ist ein auf gute Weise verschwenderischer Bau, errichtet vor fast 180 Jahren, mit stuckverziertem Speisesaal, eigen, ornamentreich. Heute riecht es hier nach Urin, Scheiben sind eingeschlagen, an die Wände haben Jugendliche »Ich hasse Jennifer« oder »Sex« gekritzelt. Buchladen, Imbiss, Fahrkartenschalter – alles schloss irgendwann.
Vom Bahnhof führt eine Straße hinab ins Zentrum. Eine Zeit lang standen dort hauptsächlich Antiquitätenläden. Sie hießen An- und Verkauf, Trendartikel, SecondHandShop oder Ramschkiste. In ihren Schaufenstern lagen Babypuppen, Postkarten, Radkappen, Nägel und Amiga-Schallplatten von Boney M. Damals dachte ich, dass neben den 1-Euro-Läden die Antiquitätengeschäfte noch die einzigen Händler meiner Heimatstadt wären. Ich dachte: ›Vielleicht verkaufen sie sich ihre Antiquitäten gegenseitig.‹ Auf den Heckfenstern der leeren Busse klebte ein Spruch des Gewerbeverbunds: »Fahr nicht fort / Kauf im Ort!«
Diese Stadt, meine Geburtsstadt, ist nicht klein. Aber sie war einmal größer. Fabriken gab es hier, Gaststätten, stets im erweiterten Plural. Später waren Schaufenster mit Sperrholzplatten geschützt, Häuser eingezäunt, der Gehweg davor war gesperrt, die Einsturzgefahr hoch. Würde man jedes leerstehende Haus der Hauptstraße abreißen, würde sie an die Zahnreihe eines müden, viel zu oft geschlagenen Boxers erinnern.
Ich sehe die Straßenkreuzung, auf der ein LKW in ein Auto raste und ein Mädchen auf dem Weg zur Schule tötete. Ich sehe den Hügel, wo die Brauerei stand, und wie viele kenne ich die Mutmaßungen darüber, wer sie in Brand gesteckt haben soll. Ich sehe den Mann mit dem Feuermal im Gesicht, dem die Kinder nachlachen. Vor vielen Jahren ist er auch schon durch die Straßen gehumpelt und damals haben wir mit den Fingern auf ihn gezeigt. Ich weiß, was wir über den Mann sagten, der in seiner hinteren Hosentasche immer einen Kamm trug. Ich habe mich niemals mit ihm unterhalten. Ich höre die alten Leute erzählen, dass dort, wo heute der Supermarkt steht, 1951 ein Fleischer war. Ich könnte den Erstbesten ansprechen und obwohl wir uns nicht kennen würden, könnten wir zwei Stunden über meinen Heimatort reden.
Es sind andere Augen, mit denen ich heute auf das Graffiti an den Wänden schaue, über das die Lokalzeitung so oft aufgebrachte Artikel geschrieben hatte. Auch das Graffiti schaut mich anders an. Es weiß nicht so genau, wo es mich einzuordnen hat. In diesen Ort? Bin ich nicht viel zu lange schon weg? Lebe ich nicht schon länger woanders, als ich je hier gelebt habe? Habe ich überhaupt noch das Recht, über diese Stadt zu schreiben? Ist sie wirklich noch Heimatstadt oder längst Erinnerung und alles, was ich heute sehe, beziehe ich auf ein Gestern? Ist dieser Blick nicht unfair gegenüber der Gegenwart, den Menschen heute? Gibt es wirklich noch Sperrholzplatten vor den Geschäften und wenn ja, warum schreibe ich am Anfang dieses Textteils ausgerechnet darüber? Was schreibe ich über dieses Werdau, das vor dreißig Jahren existierte und heute noch?
Es ist keine Sinnsuche, der Weg vorbei an diesen Plätzen, die getränkt sind mit vergangenen Gerüchen und Ängsten und Sehnsüchten. Zuhause ist ein Ort mit verschiedenen Zeiten. Es ist immer gestern und auch deshalb kommt man zurück. Mit jedem Wiederkommen wächst der Ort, unsichtbar, nur für mich selbst, aber er wächst unaufhörlich.
III. Mit Fengari in der Mitropa zu Weihnachten

Es gab keine Plakate, keine Flyer, keinen Post auf Facebook. Nur Textnachrichten, Telefonate, von Mund zu Mund haben wir die Kunde von diesem Abend verbreitet: Die Weggezogenen kommen über Weihnachten zurück in die alte Stadt. Sie treffen sich in der lange schon geschlossenen Mitropa im Bahnhof. Fengari soll spielen, ihre Mixe fünfzehn Jahre alt.
Es ist nur halb erlaubt, hier zu sein und das macht auch den Reiz aus. Die Schlösser an den Ketten zu knacken, die schwere Tür so zu öffnen, dass sich die Leute vom Amt später wundern, dass sie sich überhaupt öffnen ließ. Ein bisschen wild sein, ein bisschen wie gestern sein, einen Ort für eine Nacht zu einem eigenen machen. Wir wollen nichts zerstören, nicht »Sex« an die Wände der Bahnhofshalle schreiben oder Scheiben einwerfen. Wir wollen der Stadt nichts Böses. Wir wollen feiern, dass die Stadt und wir unfreiwillig ein Bündnis eingegangen waren und wir alle das Beste daraus machen mussten.
Jetzt spielt es keine Rolle, wie die Stadt über uns denkt. Wie wir über sie dachten. Gerade gibt es die, die tanzen. Die Beats sind klar und schnell, viele Höhen, viele Drops, das, was man damals als Drop verstand. Mehr noch reden miteinander. So viel Leben ist passiert seit damals. Jeder von uns ist etwas geworden. Einige sind schon gegangen: die Autos an den Bäumen, die boshaft geteilten Zellen, die Leere.
In der Mitropa bei Fengari befindet sich eine Zeitmaschine in die Vergangenheit. Vor dem Bahnhof ist die Gegenwart. Vor dem Bahnhofsgebäude, bei den Bushaltestellen steht eine Gruppe von Teenagern. Sie sehen, wie wir in diese Zeitmaschine einsteigen. Die Teenager finden seltsam, was passiert. Sie finden uns bizarr: diese Alten, diese Musik, diese Umarmungen, dieses Erinnern, dieses peinliche Drogennehmen, diese wenigeren Haare, diese selige Nostalgie. Die Teenager sind erstaunt, dass an diesem stillgelegten Ort etwas stattfindet. Und sie sind euphorisiert davon: alles besser als diese Stadt, selbst Fengari in der Mitropa. Sie geben sich alle Mühe, sich diese verwirrende Vielzahl an Gefühlen nicht anmerken zu lassen. Sie schreien, sie stoßen sich, küssen, trinken und rennen irgendwann weg, die Bahnhofstraße hinunter.
In fünfzig, in siebzig Jahren werden wir gestorben sein. Eine von uns wird die Letzte sein. Niemand sonst wird dann mehr in diesen Stunden in dieser Nacht hier im Bahnhof gewesen sein. Niemand sonst wird davon berichten können. Niemand wird verstehen können, wie es war, mit Fengari in der Mitropa zu Weihnachten.
IV. Versuch keiner Verletzung

Wie kann ich von dir erzählen, ohne mich und dich zu verletzen? So viele Momente bisher mit dir.
Du
bist die Hauptstraße, die benannt ist nach einem sozialdemokratischen Arbeiterführer
bist die Tattoostudios und Piercingbuden zu ihrer Rechten
bist das neugemachte Verkehrskreisel
bist die Steuermittel aus dem Solidaritätszuschlag, die in all die gepflasterten Gehwege geflossen sind
bist die ehemaligen ABM-Kräfte
bist die Arbeitslosen, die sich vor dem Penny trafen
bist die Pilze, Pillen, Bongs
bist die Amstaff-Trainingsanzüge, Life-is-Pain-Cargohosen und Kampfhunde
bist das Capri und all die Dates dort
bis die Bruchbude und die glorreichen Konzerte, die wir dort hörten
bist der Atheismus, den wir mit der Muttermilch aufgesogen haben
bist das unverblümte Ablehnen
das Wehklagen, das Wegducken, das Immer-etwas-kleiner-machen-als-man-ist
bist das Nichthochdeutsche in jedem deiner Wörter
bist die wunderschönen Wörter, die dabei entstehen – draschen – und dass woanders diese Schönheit verlacht wird
bist Du Vogel, ich poch dir vorn Hals
bist das Einwandfrei als höchstes deiner Lobesworte
bist die Roulade mit Speck zu Weihnachten
bist das Grillen und dass du für jeden eine Roster bereithältst, eigentlich für jeden zwei und für die Nichte sogar in Alufolie gewickeltes Gemüse
bist die Orte, zu denen man mit roten Schnürsenkeln nicht hingegangen ist
bist die Plattenbausiedlung, deren Fassaden mit bunten Farben angestrichen sind
bist die andere Plattenbausiedlung, deren Fassaden mit Bildern blumenkranztragender Frauen bemalt sind
bist die Subwoofer der Skodas abends an den Tankstellen
bist die Powerchords der Onkelz aus heruntergefahrenen Autofenstern
bist, dass niemand Berühmtes hier geboren wurde und niemand wirklich Berühmtes hier gewesen ist außer Dieter Bohlen vor vierzig Jahren im Stadtpark
bist, dass hier nur selten der Bürgermeister ein zweites Mal gewählt wird
bist das Zaudern
bist die Wachsschürzen der Großmütter
die Werkzeugkeller der Großväter
bist die abgerissene Freilichtbühne am Roten Berg
bist die lange Zeit verlassene Voliere, weil jemand die Vögel darin vergiftet hat
bist die bunten Wägelchen, in denen Kindergärtnerinnen die Einjährigen vormittags am exquisiten Fischladen vorbeiziehen
bist die Garagen, die sich die Jugendlichen gemietet haben, um darin für sich zu sein
bist die Abendgarderobe der Rathauskonzerte
bist der eingeübte Disco-Fox auf dem Abiball
bist das Fest zum Kindertag auf dem Marktplatz, das der Verein der Vietnamesen Westsachsen mit organisiert
bist die Rapsfelder, die dich im Mai so strahlend umschließen
bist die Zeit der Villabesitzer, seit der über hundert Jahre vergangen ist
bist die Geschichte meiner Familie, meiner Freunde und guten Nachbarn, jeder Augenblick von Wichtigkeit
bist die Normalität, das, was du für normal hältst
bist, dass ich jedem von außerhalb erklären muss, woher ich stamme, oder ich sage: »bei Zwickau«
bist die Geschäfte, die Pakete annehmen, weil du keine Post mehr hast
bist die Umleitungen, die ein Jahr lang umleiten, bist die Sportplätze bei den Eisenbahnschienen
bist das Hallenbad, das auf dem Gelände des zugeschütteten Freibads steht
bist die grandiosen Rodelhügel,
ist Friedhof meiner Vorfahren
bist Geschichte und ringst darum, weiter eine zu haben
bist eine Pop-Up-Kunstausstellung im ehemaligen Aerocitwerk
bist das seit über dreißig Jahren geschlossene Lichtspielhaus im Art-déco-Stil mit dem Depeche-Mode-Graffiti auf der verfallenden Fassade
bist Bleiben und Weggang
bist Amtsblatt und Bierfassanstich
bist die WhatsApp-Gruppe, mit der Müllwegräumaktionen organisiert werden
bist die Plastikostereier, die an den Brunnen am Markt gehangen werden und wenn Vandalen sie abreißen, hängst du sie trotzig ein zweites Mal auf
bist der Pilzpfannenverkäufer auf dem Straßenfest
bist das gut geführte Hotel, dessen Veranstaltungsräume an den Wochenenden mit Jubiläumsfeiern und Ehemaligentreffen voll belegt sind
bist, dass jeder Neubau mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Seniorenheim ist
bist der eine Sportverein, der für ein paar Jahre in einer zweiten Liga gewesen ist
bist, dass du mich kennst wie kein anderer Ort
du die Luft bist, die ich einatmete
der Geruch von gebratenen Nudeln an der Annoncenuhr
der Moder, der mir durch die eingeschlagenen Fenster der alten Fabriken entgegenschlug
bist die Eisenbahnbrücke, unter der zwei Kreuze stehen, immer noch stehen
bist der Fluss, der die Farben wechselte
bist die Gefälle, die ich mit dem Fahrrad hinuntergesaust bin
bist die Aufkleber der Nazis an den Straßenlaternen
bist die jämmerlich kleine Halfpipe neben der Tankstelle
bist Hintergrund der Fotos, die mir etwas bedeuten
bist keine Postkarte, die ich aus dir schreibe
bist ab 18 Uhr geschlossen, wie könnte es anders sein
bist so gut wie jeder Moment, so schlecht wie jeder Moment, ich kann die Zeit nicht wählen, in der ich lebe, aber über den Ort entscheiden, an dem ich das tue, wie soll ich von dir erzählen, als wärst du eine Sache, erzählen, als hätte ich dich mich verstanden, wie soll ich von dir erzählen, ohne mich, dich zu verklären, vergessen, erinnern, verletzen, wie soll ich?
V. Spot on

In der Woche, in der die Queen stirbt, fahre ich zum Sommerfest der sächsischen Landesvertretung nach Prag. Das Fest ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, auf der die sächsische Regierung verschiedene Aspekte Sachsens in Tschechien vorstellen lässt; eine kleine Messe mit Empfang und Musik im Gebäude mit der größten Sammlung sorabistischer Literatur außerhalb der Lausitz. Die Karlsbrücke ist nur zwei Minuten entfernt. Die Räume sind mit grün-gelben Bändern dekoriert, das Büfett ist mit Fingerfood und himbeerfarbenen Knödeln bestückt. Ein Vizeminister begrüßt, ein Staatssekretär spricht. Die Ausstellenden werden Maker genannt. Das Motto lautet: »Spot on Creative Saxony«.
Gleich in der ersten Rede wird selbstironisch darauf hingewiesen, dass es sächsisch ausgesprochen leicht zu Missverständnissen kommen und das Spot wie Spott klingen könne. Als über die zukünftige Kulturhauptstadt Chemnitz gesprochen wird, fällt der Satz: Von Marx zu Maker. Auch Werdau ist auf diesem Sommerfest vertreten: Einer der Maker stellt Fotos aus, sie zeigen Orte aus dem vierten Textteil.
Diesen fünften Textteil schreibe ich auf einem Notizblock, auf dem steht: »Gemeinsam gestalten wir ein kreatives Sachsen«. Der Bleistift, mit dem ich auf den Block schreibe, ist ein Werbemittel für Chemnitz Kulturhauptstadt 2025. Auf anderen Werbemitteln, die in Tschechien für Sachsen werben sollen, finden sich Schlagworte wie: Mut machen. Impulse geben. Sichtbarkeit. Wertschätzung. Kreative Räume weiterentwickeln. Kooperation. Workshops. Innovativ. Potenzialräume. Lebendige Innovationen finden. »Navštivte Sachsen!«, besuchen Sie Sachsen, prangt auf den Plakaten an den Wänden. Dazu sind Fotos von Bergen, Flüssen, Wäldern, Schlössern gestellt, alle sächsisch, alle idyllisch.
Werdau in Prag, zwei Tage Sachsen pur. Jeder ist überaus freundlich, jede ist interessiert zugewandt. Gespräche entstehen, Gemeinsamkeiten werden festgestellt. Man vernetzt sich. Auch ich tue dies, und obwohl ich niemanden kenne außer einem Maker, meinem engsten, längsten Freund, fällt es sehr leicht zu sprechen, weil ich mit allen sprechen kann über: Sachsen.
Ich versuche, das irgendwie zusammenzubringen: Sommerfest bei der Karlsbrücke und Fengari in der alten Mitropa. Staatssekretär und Zahnlücke in Hauptstraße. Mein Bild von Heimat und das Bild, das Andere von meiner Heimat haben. Bilder, die Andere von meiner Heimat erzeugen wollen mit Blöcken, Bleistiften, Agentursprech und Floskelwolken, mit Musik und Ständen und Reden und Broschüren und Kulturhauptstädten. Ich höre Geschichten, die gegen Geschichten gesetzt werden könnten. Das urbane Fingerfood gegen die Roster meiner Jugend.
Zwei Tage in Prag, die beharrlich gegen den ersten Textteil arbeiten wollen, die versuchen, ein Sachsen zu erschaffen in anderen Bildern mit anderen Menschen und anderen Absichten. Und es ist nicht mal falsch, weil diese Bilder ja auch etwas Wirkliches zeigen und ich mit diesen freundlichen, interessierten Menschen ja tatsächlich spreche und ich sehe an ihren Ständen ja, was sie tun, sie reißen keine Bahnhöfe ab, sie entwickeln kreative Räume in meiner Heimat, sie nutzen sie und leben sie, sie tun es seit Jahren. Spot on, ja, was kann ich eigentlich auf den Punkt bringen?
VI. Abriss

Drei Monate vor Prag lese ich in Werdau. Das Bahnhofsgebäude soll in wenigen Monaten abgerissen werden. Zukünftig soll ein funktionaler Haltepunkt das historische Gebäude ersetzen. Ein letztes Mal wird gefeiert. Diesmal soll es – anders als bei Fengari in der Mitropa zu Weihnachten – nicht heimlich sein. Eine Gruppe von Freunden hat sich dafür zusammengetan, organisiert, alles privat, auch die Finanzierung, über Crowdfunding kamen fünftausend Euro zusammen. Davor standen zahlreiche Begehungen, Besprechungen von Sicherheitskonzepten, jede Menge Formulare und Eingaben und Nachforderungen, ein frustrierendes Warten darauf, dass destruktiv agierende Leute in Ämtern widerwillig notwendige Stempel setzten.
Dann bin ich an einem Samstag in der alten Mitropa, die für diesen Anlass noch einmal groß hergerichtet ist. Da, wo die Bahnhofsuhr mal war, hängt jetzt eine Diskokugel. Zwölftklässler verkaufen Kuchen zur Finanzierung ihrer Abschlussfahrt. Die Tochter vietnamesischer Gastarbeiterinnen, die in der Sorge lebten, einem Plattenbau, zeigt einen Dokumentarfilm über das Ankommen ihrer Eltern in den 1980er Jahren in Werdau. Ich lese Teile dieser Heimatsuche vor. Vor mir sitzen langjährige Freunde, sitzen deren Kinder, sitzen ehemalige Deutschlehrerinnen, sitzt auch der Bürgermeister, hören zu, fragen später nach dem Text.
Auch später: stehen wir zusammen. Wir erzählen vom Vortag. Am Abend kamen Druffis, die mit den Pillen und dem Schnaps. Sie sammelten sich vor dem Gebäude, hockten da, brüteten Aggressivität aus, die eskalierte. Es habe Mische gegeben, heißt es. Mische hat hier mehrere Bedeutungen. Mische steht für eine Kombination aus Softgetränken mit hartem Alkohol. Steht für Marihuana. Und steht für eine Schlägerei. Letztere geschah. Die Polizei kam mit mehreren Einsatzwagen, kontrollierte, sprach Platzverweise aus. Heute, an diesem Tag, patrouilliert die Polizei schon früher. Präventives Abdrängen, Deeskalieren durch Anwesenheit, erklärt die Polizei.
Die Beschreibung der gestrigen Situation klingt dramatisch. Jetzt sind da, wo gestern die Mische war, Familien. Sie stehen vor dem Bahnhof und beklatschen ihre kleinen Mädchen, die in rosa Kostümen einen Showtanz aufführen. Jetzt sind hier Rentnerinnen, die sich die Fotoausstellung anschauen und sich erinnern an damals, als die Leute in Werdau ankamen und nicht nur wegfuhren. Jetzt sind da die Bekannten, Schulfreunde, Typen, die man früher mal kannte und deshalb immer noch kennt.
Einigen sage ich, was für ein widersprüchliches Gefühl es für mich sei, hier zu sein. Einer sagt: Sobald ich hier bin, kommen die Komplexe zurück, die ich mit vierzehn hatte. Einige überlegen, warum es in Werdau nicht gelungen ist, den Bahnhof zu beleben, so, wie es in anderen sächsischen Städten gelang, in eigentlich fast allen Städten Sachsens. Eine spricht davon, wie viele weggegangen sind. Davon, dass man hier eher sagt, was nicht möglich ist. Jemand spricht von der Mentalität dieses Ortes, unserer Heimat, in der wir fast alle nicht mehr leben.
Am Abend, es wird schon Nacht, sitze ich im Zug, der mich wegbringt von Bahnhof, Sprache, Vergangenheit. Ich höre Musik, die ich vor über zwanzig Jahren gehört habe, fahre dahin zurück, wo man die Geschichten meiner Heimat nicht kennt, die Bilder nicht, dahin, wo meine Heimat Symbol ist, keine Mische.